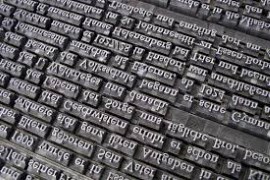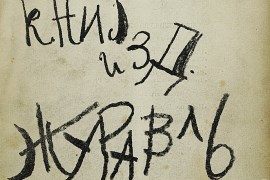Livre | Chapitre
Einleitung
pp. 9-17
Résumé
»Was heißt, und zu welchem Ende schreibt man, eine Biographie?« — Mit dieser Frage hat Hilde Spiel, ihrerseits später Verfasserin einer Biographie über Fanny von Arnstein, 1959 ihre Rezension über Hannah Arendts Rahel-Varnhagen-Biographie eröffnet.1 Sie war nicht die erste, die diese Frage stellte, und ihre Antwort ist bei weitem moderater ausgefallen als diejenige Siegfried Kracauers. Dieser hatte bekanntlich in seinem berühmten Essay von 19302 die in der Weimarer Republik grassierende »biographische Mode«3 angeprangert, die sich seinerzeit als Vorliebe für historische Belletristik äußerte. Von einer »neubürgerlichen Kunstform«4 hatte Kracauer gesprochen, die nur einem, eben dem bürgerlichen Bedürfnis nach einer heilen Welt historischer Größe und Eindeutigkeit diene, der Sehnsucht nach dem unanfechtbaren, musealen Ort, nach Vergangenheit und Geschichte entspringe und damit imaginär aus den Zwängen einer unübersichtlich gewordenen entfremdeten Wirklichkeit befreie. Vor dem Chaos der zeitgenössischen Wirklichkeit und aus dem »Chaos der gegenwärtigen Kunstübungen«5 suche man die Rettung in der Biographie.
Détails de la publication
Publié dans:
von der Lühe Irmela, Runge Anita (2001) Jahrbuch für Frauenforschung 2001: Band 6: Biographisches erzählen. Stuttgart, Metzler.
Pages: 9-17
DOI: 10.1007/978-3-476-02797-9_1
Citation complète:
von der Lühe Irmela, Runge Anita, 2001, Einleitung. In I. Von Der lühe & A. Runge (Hrsg.) Jahrbuch für Frauenforschung 2001 (9-17). Stuttgart, Metzler.