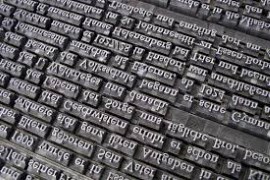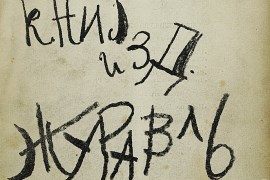Livre | Chapitre
Paradigmen
pp. 169-228
Résumé
Eine zentrale Grundlage für die Erforschung der Relation zwischen Wissen und Literatur ist die Einsicht in die Historizität von Wissen. Damit sind allerdings nicht nur die Disziplinen, Methoden oder Inhalte dieses Wissens gemeint, sondern auch die kulturellen Codes, die darüber entscheiden, ob eine Aussage überhaupt als potenziell wissenshaltig angesehen bzw. beurteilt wird. Bevor Aussagen auf das Wissenschaftssystem als ganzes angerechnet werden können, bevor sie überhaupt auf ihre Übereinstimmung mit den methodischen Wahrheitsbedingungen einer spezifischen Disziplin verglichen werden können, müssen sie in ihren Grundannahmen und ihrer Form mit demjenigen übereinstimmen, was man — je nach wissenschaftshistorischer Terminologie — als ›Weltanschauung‹ (Hans Blumenberg), ›Denkstil‹ (Ludwik Fleck), ›Episteme‹ (Michel Foucault) oder ›Paradigma‹ (Thomas S. Kuhn) eines Zeitalters bezeichnet hat. So tritt an die Stelle eines ahistorischen Verständnisses von Wissen die Einsicht, dass Wissen relativ zu historischen Bedingungssystemen entsteht und daher nach dem Wechsel in ein anderes Bedingungssystem — der bei Kuhn »Revolution« und bei Foucault »Bruch« heißt — nicht mehr als Wissen anerkannt wird.
Détails de la publication
Publié dans:
Borgards Roland, Neumeyer Harald, Pethes Nicolas, Wübben Yvonne (2013) Literatur und Wissen: ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart, Metzler.
Pages: 169-228
DOI: 10.1007/978-3-476-00595-3_3
Citation complète:
Borgards Roland, Pethes Nicolas, Schöning Matthias, Werber Niels, Heise Ursula K., 2013, Paradigmen. In R. Borgards, H. Neumeyer, N. Pethes & Y. Wübben (Hrsg.) Literatur und Wissen (169-228). Stuttgart, Metzler.